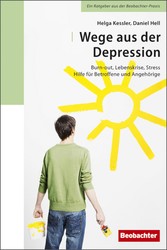
Wege aus der Depression - Burn-out, Lebenskrise, Stress - Hilfe für Betroffene und Angehörige
von: Helga Kessler, Daniel Hell, Der Schweizerische Beobachter
Beobachter-Edition, 2012
ISBN: 9783855697083
Sprache: Deutsch
209 Seiten, Download: 554 KB
Format: EPUB, PDF, auch als Online-Lesen
Mehr zum Inhalt

Wege aus der Depression - Burn-out, Lebenskrise, Stress - Hilfe für Betroffene und Angehörige
Die Seelenkrankheit kann jeden treffen
Depressionen gab es schon im Altertum, doch heute ist die Seelenfinsternis die häufigste psychische Erkrankung. Information tut not – nur so kann das Leiden entstigmatisiert und den Betroffenen geholfen werden. Allmählich nimmt das Wissen über Depressionen zu.
1
Das Krankheitsbild ist alt
Traurigkeit, Angst, Bedrücktheit, Neigung zur Selbsttötung, Appetitlosigkeit, Verzagtheit, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit und Rastlosigkeit, begleitet von unablässiger Furcht: So hat der griechische Gelehrte Hippokrates Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus die Symptome einer Krankheit geschildert, die heute weiter verbreitet ist denn je.
Nach den Vorstellungen der antiken Heiler war bei den Betroffenen das Gleichgewicht der vier Körpersäfte – Schleim, Blut, Gelbe und Schwarze Galle – gestört. Die Kranken litten unter Schwarzgalligkeit, griechisch «Melancholie». Die Symptome haben sich nicht geändert, wohl aber der Begriff. Weil die moderne Heilkunst mit der Säftelehre der Antike und des Mittelalters nichts mehr anfangen kann, nennt man die Krankheit heute nicht weniger bildhaft Depression. «Niedergedrücktheit» bedeutet das lateinische Wort, wörtlich übersetzt.
Depressionen sind kein Phänomen unserer Zeit. Es hat sie immer gegeben und es gibt sie noch heute, in allen Regionen und in allen Kulturen der Welt. Depressionen scheinen zum Menschsein dazuzugehören. Das Krankheitsbild selbst ist alt. Neu ist, dass Depressionsbehandlungen seit etwa drei Jahrzehnten massiv zunehmen, auch weil die Ärzte die Krankheit heute besser erkennen. Dazu beigetragen hat die Forschung der letzten 30 Jahre, die das Wissen über die Ursachen vermehrt und verschiedenste Behandlungsmöglichkeiten gebracht hat. Neu ist schliesslich auch, dass die Krankheit langsam enttabuisiert wird.
Eine halbe Million Betroffene in der Schweiz
Die Depression – oder Seelenfinsternis, wie sie oft auch genannt wird – ist die häufigste psychische Erkrankung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass heute weltweit 121 Millionen Menschen an Depressionen leiden, und rechnet mit einem weiteren Anstieg in den nächsten 20 Jahren. In der Schweiz leiden jährlich schätzungsweise eine halbe Million Menschen an einer depressiven Störung. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung nimmt Antidepressiva ein – nicht nur wegen Depressionen, sondern auch wegen Angststörungen, Trauerreaktionen und als Schlafhilfe.
Die Seelenkrankheit kann jeden treffen – und in jedem Lebensalter. Die Statistik sagt, dass jede dritte bis vierte Frau und jeder sechste bis achte Mann im Lauf ihres Lebens mindestens einmal eine behandlungsbedürftige Depression erleiden. In Industrieländern erkranken jährlich 10 bis 15 Prozent aller Erwachsenen an einer Depression, etwa ein Viertel davon entwickelt ein schweres Krankheitsbild. Frauen sind rund doppelt so häufig betroffen wie Männer, gefährdet sind vor allem jüngere Mütter mit kleinen Kindern ohne partnerschaftliche Unterstützung. Man vermutet auch, dass jeder vierte bis fünfte Betagte depressiv ist; bei den meisten handelt es sich um eine mildere Form. Auch Kinder und Jugendliche entwickeln zunehmend Depressionen. Schätzungsweise fünf Prozent sind von schweren Depressionen betroffen, etwa zehn Prozent zeigen depressive Symptome. Vor allem bei 15- bis 20-jährigen Jugendlichen nehmen depressive Störungen stark zu.
Insbesondere bei alten Menschen und Kindern werden Depressionen oft nicht erkannt und folglich auch nicht behandelt. Das führt dazu, dass die Erkrankung nicht selten einen ungünstigen Verlauf nimmt.
Warum nehmen Depressionen zu? Depressionen mögen zum Menschsein dazugehören. Doch weshalb steigen dann die Behandlungszahlen so enorm an? Eine Erklärung könnte sein, dass das Krankheitsbild heute besser erkannt und dass bereits in weniger ausgeprägten Fällen eine Diagnose gestellt wird. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Menschen eher über psychische Probleme reden können als früher. Oder daran, dass es einfacher ist, sich zu einem Burnout zu bekennen als zu einer Depression. Der Journalist Andrew Solomon wiederum, der selbst immer wieder unter depressiven Schüben leidet, hält die gestiegenen Krankheitszahlen für eine Folge der Moderne: «Die Hektik und das technische Chaos, die Entfremdung, der Verlust traditioneller Familienstrukturen und die endemische Einsamkeit, das Versagen der religiösen, moralischen, politischen und sozialen Glaubenssysteme, die dem Leben einst Sinn oder Richtung zu geben schienen, wirkten sich wahrhaft katastrophal aus.»
Die steigende Zahl von Depressionsbehandlungen könnte schliesslich darauf zurückzuführen sein, dass es immer schwieriger wird, in einem auch nur leicht depressiven Zustand im modernen Alltags- und Berufsleben zu bestehen. Ein depressiver Mensch kann nicht erfüllen, was vom spätmodernen Menschen zunehmend erwartet wird, nämlich Schnelligkeit, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Kurzentschlossenheit.
Eine Frage des Geschlechts
Während im Kindesalter Depressionen bei beiden Geschlechtern etwa gleich häufig vorkommen, verändert sich das Geschlechterverhältnis mit der Pubertät: Die Depression wird weiblich.
Frauen leiden etwa doppelt so häufig unter depressiven Störungen wie Männer. Sie sind nicht nur häufiger betroffen, sondern zeigen auch andere Symptome und einen anderen Verlauf der Krankheit. Während Frauen mit depressiven Störungen eher zum Grübeln und zu Selbstbeschuldigungen neigen und dadurch ihren Zustand verschlimmern, greifen Männer eher zu Suchtmitteln, reagieren aggressiv und begehen häufiger Suizid *.
Weibliche Depression
Weshalb Frauen häufiger depressiv werden als Männer, ist bis heute unklar. Anita Riecher-Rössler von der Psychiatrischen Universitätspoliklinik in Basel sieht mehrere Gründe für den Geschlechtsunterschied: Biologische, psychosoziale und kulturelle Faktoren könnten einzeln, aber auch zusammen eine Rolle spielen. So könnten Sexualhormone oder Ereignisse wie Menstruation, Geburt oder Menopause am Entstehen einer Depression beteiligt sein (siehe Kapitel Die wichtigsten Auslöser, Seite 103). Die Forschung zeige ausserdem, dass Mädchen eher zu «gelernter Hilflosigkeit» und geringerem Selbstvertrauen neigten und weniger auf ihre Stärken vertrauten, während Buben eher zu aktiver Bewältigung erzogen würden. Auch das unterschiedliche Rollenverhalten kann, so Riecher-Rössler, das Depressionsrisiko erhöhen. Frauen stünden eher in starken Abhängigkeiten – in Partnerschaft und Beruf –, ohne Möglichkeit, etwas daran ändern zu können. Auch seien Frauen häufiger als Männer Gewalt, physischem oder sexuellem Missbrauch ausgesetzt. Schliesslich lebten Frauen häufiger unter der Armutsgrenze, besonders alleinerziehende Mütter.
Dass verheiratete Frauen zwischen 25 und 45 Jahren, vielfach jüngere Mütter, vermehrt betroffen sind, könnte dafür sprechen, dass die Depression eine Reaktion auf übergrosse Belastung ist. Andere erklären den Anstieg bei jüngeren Frauen damit, dass die Ansprüche der Gesellschaft generell gestiegen seien. Verlangt würden Karriere, ein schöner Körper, eine gut funktionierende Beziehung, permanentes Glück. Damit wachse die Gefahr von Versagensgefühlen und mithin einer Depression. Angeführt wird zudem, dass Frauen ihre Beschwerden besser wahrnähmen als Männer und eher darüber redeten. Das führe dazu, dass bei Frauen die Diagnose eher gestellt werde als bei Männern.
Die Gene sind beteiligt
Möglicherweise liegen die Gründe für das häufigere Auftreten von Depressionen bei Frauen zumindest teilweise in den Genen. Forscher der Universität Pittsburgh untersuchten die Gene von 200 Männern und Frauen, von denen die Hälfte unter chronischen Depressionen litt. Dabei machten die Wissenschaftler insgesamt 19 Genregionen aus, die sich mit Depression in Verbindung bringen lassen. 16 davon wirkten sich aber nur entweder bei Männern oder Frauen aus. Die Forscher spekulieren nun, dass die molekularen Vorgänge im Gehirn bei depressiven Frauen anders sind als bei depressiven Männern. Wie Riecher-Rössler empfehlen auch die amerikanischen Forscher, Diagnose und Therapie besser an das jeweilige Geschlecht anzupassen.
Männliche Depression
Bei Männern werden Depressionen deutlich seltener diagnostiziert als bei Frauen. Bedeutet das, dass sie tatsächlich ein geringeres Depressionsrisiko haben? Oder könnte es sein, dass die Krankheit Depression als «weiblich» etikettiert und deshalb sowohl von den betroffenen Männern wie auch von Ärzten nicht erkannt wird, zumal Männer andere Symptome zeigen als Frauen? Verschiedene Untersuchungen deuten darauf hin, dass Depressionen bei Männern häufig unerkannt...









